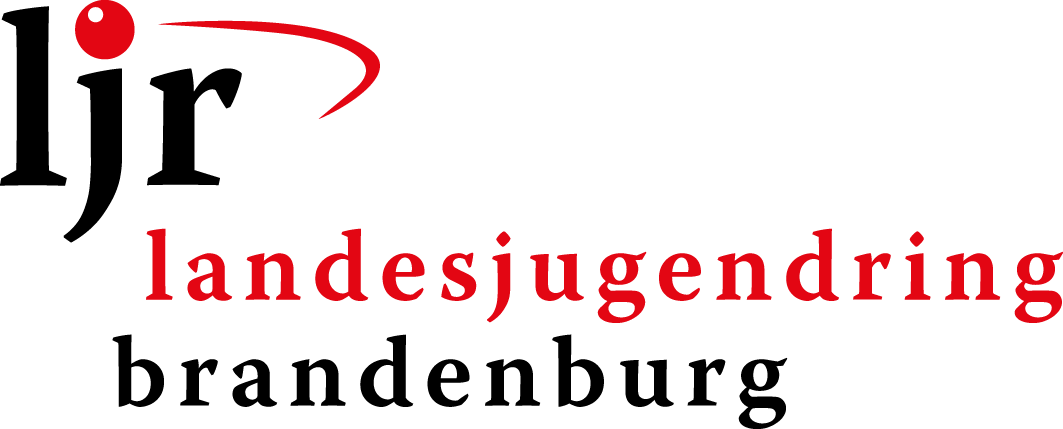13 Gruppen werden von März bis November 2024 ihre Projektideen umsetzen und bei sich vor Ort nach lokalen Spuren der Geschichte suchen. Was sie vorhaben, lest ihr hier:
﹀'Trotz und Träume - Erinnerungen an die Jugend in der Prignitz 1949-1989', 16928 Pritzwalk, Prignitz
Projektort: 16928 Pritzwalk
Landkreis: Prignitz
Träger: Berlin-Brandenburgische Landjugend e.V.
Die 14 jungen Menschen im Alter von 16-19 Jahren aus Pritzwalk und Umgebung kennen sich aus einer AG an der Schule. Ausgehend von Interviews in ihren Familien beschäftigen sie sich in ihrer Freizeit mit dem Alltag von jungen Menschen in der Prignitz in der Zeit der DDR.
Sie fragen ältere Menschen, nach ihrem Alltag im ländlichen Raum. Fragen, die sie dabei leiten sind:
• Wie war es als Kind und Jugendliche*r in der DDR aufzuwachsen?
• Was waren Wünsche und Träume?
• Wie war der Berufsalltag, wie war das Arbeiten im Kollektiv?
• Wie konnte die Freizeit gestaltet werden?
• Was war schön in dieser Zeit?
• Welche Erinnerungen sind wertvoll und sollen weitererzählt werden?
• Gibt es einen Tag im Leben, der besonders ist?
• aber auch: was waren schlimme Erfahrungen?
Neben den Interviews greifen sie dabei auf Fotoalben und Erinnerungsstücke zurück.
Besuche der Gedenkstätte Lindenstraße 54 in Potsdam oder des Jugendwiderstandsmuseum in Berlin-Friedrichshain geben weitere Einblicke in die Lebenswelten jener junger Menschen, die sich als Teil dissidenter Jugendkulturen verstanden haben. In weiteren Workshops, zu dem auch Zeitzeug*innen eingeladen werden, eigenen sie sich dazu weiteres Wissen an.
Das Projekt hat einen medienpädagogischen Ansatz und arbeitet mit Methoden der lebensweltlichen Spurensuche. Fotogeschichten entstehen, die von persönlichen Begegnungen und Gesprächen mit Zeitzeug*innen inspiriert sind. Die Ergebnisse werden in Ausstellungen an verschieden Orten in der Prignitz gezeigt. Angefragt sind unter anderem die Museumsfabrik Pritzwalk, der Stadtsalon Safari in Wittenberge und das Kulturkombinat Perleberg.
﹀'Der Traum von Freiheit • Sehnsucht und Lebensgefühl in der DDR. Eine regionale Spurensuche', 19322 Wittenberge, Prignitz
Projektort: 19322 Wittenberge
Landkreis: Prignitz
Träger: Walter-Hoffmann-Axthelm Stiftung
Einige der sieben Jugendlichen haben bereits und Lebensgeschichten von Prignitzer*innen kennengelernt und somit regionale Geschichte erforscht. In diesem Projekt geht es nun darum, wie Menschen in der DDR mit Freiheit und Unfreiheit umgingen, welche verbalen Möglichkeiten sie hatten, sich über Witze, Texte, Lieder, Musik versteckt zu verständigen?
Eine Rolle bei ihrer Recherche spielen Transitraststätten, Intershops und die ehemalige Fernstraße F5, die um Perleberg verlief und Westberlin und Westdeutschland verband. Ebenso Westpakete und Postkarten als Symbole der Teilung Deutschlands. Durch Inter-views mit Zeitzeug*innen, Recherchen vor Ort und dem Studieren historischer Dokumente sollen die Lebensgefühle unterschiedlicher Personen in der DDR in den Blick genommen werden. Jedoch nach dem Mauerfall sind die Grenzen offen, das Leben aller DDR-Bürger ändert sich. Die Sehnsucht vieler Menschen trifft im Prozess der Wiedervereinigung auf Unerwartetes.
Heute können Jugendliche Informationen über Lebensgefühl und Sehnsucht in der DDR zwar nachlesen, jedoch wie Menschen, die hier in der Region lebten, mit ihren Sehnsüch-ten umgingen, können sie nur persönlich von Zeitzeugen erfragen. Sie werden auch in Er-fahrung bringen, wie diese Personen geprägt wurden und welche Werte sie heute leiten, wie sie heute handeln würden, wenn sie noch einmal jung wären: Hätten sie mutiger ge-handelt, wenn sie gewusst hätten, dass die Mauer fällt und die Grenzen 1989 geöffnet werden?
Vor den Interviews erleben die Jugendlichen erfahrungsorientierte Übungen der Demo-kratiebildung, befassen sich mit den Grundzügen von Gesellschaft, erkennen, welche Stär-ken Demokratie hat.
Ziel ist es, Lebensgeschichten in Text und Bild zu sammeln, Erkenntnisse zu reflektieren, Er-gebnisse zusammenzuführen und Plakate zu gestalten, um diese öffentlich zu präsentieren in den Räumen von Projektpartnern wie OSZ und Museum.
﹀'Hirschluch im Wandel der Zeit', 15859 Storkow (Mark), OT Hirschluch, Landkreis Oder-Spree
Projektort: 15859 Storkow (Mark), OT Hirschluch
Landkreis: Landkreis Oder-Spree
Träger: JUSEV in Kooperation mit der EJBO
Die Projektgruppe „Hirschluch im Wandel der Zeit“ möchte die Geschichte und Gegenwart des Hauses in Hirschluch kritisch hinterfragen und aufarbeiten. Sie wollen Leerstellen in der Geschichte identifizieren und erforschen, um eine verantwortungsvolle Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu ermöglichen. Dabei soll auch die Rolle der Kirche als Eigentümerin des Hauses kritisch betrachtet werden. Durch Recherchen in Archiven, Gespräche mit Zeitzeug*innen und Unterstützung von Expert*innen, wie der Landespfarrerin für Erinnerungskultur, erhalten die Jugendlichen ein umfassendes Bild der Geschichte von Hirschluch.
Die Ergebnisse des Projekts werden in Form einer dokumentarischen Arbeit festgehalten. Diese soll öffentlich zugänglich gemacht werden, unter anderem durch die Integration auf der Homepage des Hauses mit interaktiven Elementen. Die Bildungsstätte verfügt über ein medienpädagogisches Studio, das bei der Umsetzung hilfreich sein wird. Eine öffentliche Präsentation der Ergebnisse ist geplant, bei der Politiker*innen, Nachbar*innen und Einwohner*innen eingeladen werden. Diese Präsentation wird im Rahmen der 100 Jahr-Feierlichkeiten stattfinden und voraussichtlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
﹀'Rüstzeitheim im Nationalsozialismus', 15806 Zossen OT Wünsdorf, Landkreis Teltow-Fläming
Projektort: 15806 Zossen OT Wünsdorf
Landkreis: Teltow-Fläming
Träger: EJBO – Evangelische Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Die sechs jungen Menschen, im Alter von 14 – 27 Jahren, der Evangelischen-Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz wollen die Geschichte „ihres“ Hauses erforschen. „Ihr Haus“, das ist das „Helmut-Gollwitzer-Haus“, eine evangelische Jugendbildungsstätte in Wünsdorf. Hier trafen und treffen sie sich, um ihre Verbandsarbeit zu leben, sich fortzubilden und Aktionen zu planen. 2022 wurde das Haus 100 Jahre alt. Anlass für die Jugendgruppe sich näher mit der Geschichte des Hauses und dem verantwortungsvollen Umgang dieser zu beschäftigen, denn in diesem Zusammenhang fiel auf, dass die Geschichte des Hauses in der NS-Zeit nicht erforscht ist. Hinweise wie der auf ein Treffen vor den Bücherverbrennungen im Dorf selbst werfen die Frage nach Mittäterschaft, Widerstand oder scheinbarer Gleichgültigkeit des Hauses im Verhältnis zur NS-Ideologie auf. Hier soll Licht ins Dunkel gebracht werden! Die Jugendlichen wollen die Geschichte des Rüstzeitheims in der NS-Zeit erforschen. Welche Rolle spielte das Haus in Wünsdorf mit seiner Bunkerstadt als Oberkommando der Wehrmacht?
Um Antworten auf ihre Fragen zu bekommen, möchte die Gruppe in Archiven forschen, u.a. im Archiv der Landeskirche. Die Landespfarrerin für Erinnerungskultur hat u.a. ihre Unterstützung zugesagt. Auch einzelne Zeitzeug*innen leben noch und können befragt werden. Desweiteren ist es möglich, Anwohner*innen zu ihren Erinnerungen zu kontaktieren.
Die Informationen, die zusammengetragen werden, werden (medial) für die Hompage der Bildungsstätte aufbereitet und dort veröffentlicht. Ziel ist es zudem, eine öffentliche Präsentation unter Einbeziehung von Politik, Nachbar*innen und Einwohner*innen durchzuführen.
﹀'Geschichte geht durch den Magen', 16868 Wusterhausen, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Projektort: 16868 Wusterhausen
Landkreis: Ostprignitz-Ruppin
Träger: Berlin-Brandenburgische Landjugend e.V.
Eine Gruppe von zehn jungen Menschen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren hat sich unter dem Thema „Geschichte geht durch den Magen“ zusammengefunden. Die Projektgruppe wird von einer Sozialarbeiterin geleitet, die in der mobilen Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Wusterhausen tätig ist und den Jugendclub Wusterhausen betreut, wo sich die Teilnehmer regelmäßig treffen.
Im Rahmen des Projekts setzen sich die Teilnehmer mit Kochrezepten aus der DDR-Zeit auseinander und erleben Geschichte auf kulinarische Weise. Durch den Austausch von Generationen werden Erinnerungen geweckt und lokale Orte wie die ehemalige Schulküche und Gaststätten vor Ort betrachtet. Die jungen Menschen möchten mehr über den Alltag in der DDR erfahren und reflektieren dabei auch ihre eigene Rolle in der Geschichte.
Durch die Zubereitung von DDR-Rezepten tauchen die Teilnehmer in die Vergangenheit ein und machen das Leben und den Alltag der Menschen zu dieser Zeit erlebbar. Sie kommen mit Anwohnern ins Gespräch, um zu erfahren, was sich seitdem verändert hat und ob es früher gesündere Ernährungsgewohnheiten gab. Der Blick in alte Kochbücher eröffnet eine neue Perspektive auf historische Ereignisse.
Das Ziel des Projekts ist es, ein Rezeptheft als Ergebnis zu erstellen. Die Jugendlichen beschäftigen sich mit gesunder und nachhaltiger Ernährung, vergleichen heute mit gestern und fördern das Zusammenleben von Alt und Jung in der Gemeinde. Durch das gemeinsame Kochen und Essen sollen die Bewohner näher zusammengebracht werden und ein Verständnis für die Geschichte sowie die Veränderungen im Laufe der Zeit geschaffen werden. Beim bereits etablierten Wusterhausener „Dinner in Weiß“ finden Jugendliche, Zeitzeug*innen, Nachbar*innen und auch die Kooperationspartner*innen vom Wegemuseum zum Abschluss des Projektes zusammen.
﹀'AG Stolpersteine - Auf den Spuren von Ilse Pick', 03149 Forst, Landkreis Spree-Neiße
Projektort: 03149 Forst
Landkreis: SPN
Träger: Diakonisches Werk Niederlausitz
Sechs Jugendliche in der Stadt Forst haben sich zusammengeschlossen, um das kaum noch präsente jüdische Leben in ihrer Stadt zu erforschen. Obwohl es einen Gedenkstein für die ehemalige Synagoge und den jüdischen Friedhof auf polnischer Seite gibt, ist vielen Menschen nicht bewusst, dass einst jüdisches Leben in Forst existierte. Die Verlegung von Stolpersteinen ist ein zentrales Element diese Erinnerung zu wecken.
Der Impuls für diese Gruppe kam von der Schulsozialarbeitern der Schule (Nix e.V.) und der Projektmitarbeiterin im Respekt Coaches Programm (Diakonisches Werk Niederlausitz), die ebenfalls an der Schule tätig ist. Beide sind Teil der städtischen AG Stolpersteine sind. Je intensiver sich die Jugendlichen mit dem Thema beschäftigen, desto mehr tritt der Name Ilse Pick hervor. Das Ziel ist es, so viele Informationen über die junge Forster Jüdin, die aus der Stadt deportiert und 1943 in Ausschwitz ermordet wurde, zu recherchieren, damit ihr Stolperstein im Herbst 2024 verlegt werden kann. Darüber hinaus strebt die Gruppe danach, mehr über das jüdische Leben in der Region Forst´ zu erfahren und plant Besuche an Orten jüdischen Glaubens und Gedenkstätten.
Die Recherche für die Verlegung der Stolpersteine erfordert nicht nur Geburts- und Sterbedaten der Betroffenen, sondern auch eine umfassende Sammlung von Informationen über die Biografien verfolgter Menschen. Denn es geht darum, Ilse Pick als Mensch zu beschreiben, ihre Menschlichkeit in der Stadt präsent zu machen.
Aktuell führt die Gruppe Recherchen im Internet durch, unter anderem auf Ahnenforschungsseiten. Eventuell gibt es Nachfahren von Verwandten Ilse Picks in den USA. Zudem wurden Anfragen an das Arolsen Archiv gestellt. Als nächste Schritte stehen Recherchen u.a. im Stadtarchiv der Stadt Forst sowie in Kirchenbüchern an.
﹀'Ein Nachbarschaftshaus mit viel Geschichte: Der Lottenhof in Potsdam West', 14471 Potsdam
Projektort: 14471 Potsdam West
Landkreis: Potsdam
Träger: Stadtteilnetzwerk Potsdam West e.V.
Der Lottenhof in Potsdam West hat sich trotz laufender Bau- und Sanierungsarbeiten zu einem lebendigen Treffpunkt für die Nachbarschaft entwickelt. Die wechselvolle Geschichte dieses Ortes ist bisher wenig erforscht und bekannt, was die Jugendgruppe dazu motiviert, diese „Erinnerungslücke“ zu schließen. Durch Archivrecherchen bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, im Potsdam Museum, der Gedenkstätte Lindenstraße und anderen Partnern erhoffen sie sich bisher unbekannte Fundstücke zu entdecken. Eine Sammlung von Zeitzeug*innen-Interviews im Stadtteilnetzwerk Potsdam-West e. V. dient bereits als Grundlage und wird weiter ergänzt. Die Idee für das Projekt entstand mit Beginn der Sanierungsplanungen im Stadtteilnetzwerk, in dessen Prozess auch viele Menschen aus der Nachbarschaft und ganz Potsdam Interesse an der Geschichte des Lottenhofs zeigen.
Das Jugendgeschichtsprojekt erforscht die Geschichte des markanten Gebäudes und des Geländes des Lottenhofs in Potsdam West, das seit 200 Jahren verschiedene Nutzungen erlebt hat – von einer königlichen Baumschule über Reformideen in den Jahren der Weimarer Republik bis hin zur Konsum-Gaststätte „Charlottenhof“ und der Diskothek „Charlie“ nach dem Mauerfall bis zum heutigen Nachbarschaftstreff. Das Gebäude der ehemaligen Gaststätte soll 2026/27 als Nachbarschaftshaus eröffnen. Die Gruppe plant verschiedene Präsentationsformen wie eine Freiluftausstellung auf dem Gelände des Lottenhofs oder im Gebäude selbst, eine Broschüre sowie Kurz-Podcasts zum Herunterladen per QR-Code, möglicherweise auch audiovisuell.
﹀'Das Waschhaus - ein WaschGANG durch die Geschichte', 14473 Potsdam
Projektort: 14473 Potsdam
Landkreis: Potsdam
Träger: Stiftung SPI – clubmitte
Das Waschhaus hat sich seit den 90er Jahren zu einem der führenden Kulturanbieter der Stadt entwickelt, doch nur wenige kennen die Ursprünge des Hauses und den schwierigen Übergang vom besetzten Haus zur freien Trägerschaft bis hin zur Etablierung als eines der größten soziokulturellen Zentren der Stadt. Mit einer Jugendgruppe von fünf Jugendlichen im Alter von 16-18 Jahren wird die faszinierende Geschichte des Hauses erforscht und die Möglichkeiten des Standortes zwischen Kunst und Kommerz ausgelotet. Die Jugendlichen sind Teil der offenen Jugendarbeit im Jugendclub und regelmäßige Besucher im Rahmen eines Bandprojektes.
Mit diesem Projekt wird das retrospektive Denken der Jugendlichen gefördert und untersucht, wie die Schaffung freier Räume für die Umsetzung eigener Ideen und Projekte im Spannungsfeld zwischen freier Szene und Kommerzialisierung gelingen kann. Welche Entwicklung hat der Ort auf seinem Weg von einem besetzten Haus zu einem der vielseitigsten und besucherstärksten Kulturbetriebe in Brandenburg durchlaufen? Für die Umsetzung des Vorhabens sind Recherchen in Print- und Digitalmedien zur Geschichte und Nutzung des Hauses, insbesondere für den Zeitraum vor 1990, geplant.
Die Recherche werden durch Zeitzeug*inneninterviews ergänzt, um die Entwicklung als Kulturstandort nachvollziehbar zu machen. Geplant sind Interviews mit Ralf Petsching – einem der Initiatoren der Hausbesetzung, Katja Dietrich-Kröck, die als DJane begann und später viele Jahre als Programmmanagerin und künstlerische Leiterin tätig war, sowie dem heutigen Geschäftsführer Mathias Paselk. Die Ergebnisse werden in einer Broschüre dokumentiert, die historisches und aktuelles Bildmaterial mit den Zeitzeug*inneninterviews verknüpft. Eine kleine Projektpräsentation ist vor Ort imJugendtreff clubmitte geplant.
﹀'Und (an) was glaubst du? (mehrgenerationale Perspektiven auf Religions- und Glaubensfragen)', 14467 Potsdam
Projektort: 14467 Potsdam
Landkreis: Potsdam
Träger: Stiftung Garnisonkirche
Potsdam kann viele Geschichten erzählen. Welche Orte, welche Menschen und welche Quellen aus der früheren Bezirkshauptstadt bezeugen die Glaubenspraxis von Religionsgemeinschaften in der DDR?
Dies wollen drei engagierte Freiwillige mit ihrer Projektbegleiterin erforschen. In ihrem lokalen Geschichtsprojekt tauchen sie aktiv in DDR-Zeit ein und beschäftigen sich am Beispiel der damaligen wie heutigen religiösen Gemeinschaften in Potsdam mit dem (Stellen-)Wert der Glaubens- und Religionsfreiheit. Hierzu untersuchen sie das christliche, jüdische und muslimische Leben in der SED-Diktatur und dokumentieren staatliche Einflüsse sowie Handlungsspielräume. Das Ziel ist es, Erinnerungen und Erfahrungen zu teilen und den intergenerationellen Dialog zu fördern.
Geplant sind Interviews mit Zeitzeug*innen, Besuche von für das Thema wichtigen Orten und Beschäftigung mit Quellen. Mit Unterstützung eines Historikers und eines Medienpädagogen will die Gruppe Geschichten erzählen, die aus ihrer Perspektive Schlaglichter auf das religiöse Leben in Potsdam zu DDR-Zeit werfen. Im Projekt soll ein Podcast erstellt werden, um das Thema sowie die Erinnerungen der Zeitzeug*innen insbesondere für junge Menschen zugänglich zu machen.
Mit ihrem Projekt setzt sich die Gruppe intensiv mit der Bedeutung von Glaube und Religionsfreiheit in Diktatur und Demokratie auseinander und lädt zur Diskussion über diese wichtigen Themen ein.
﹀'Gemeinsam oder geteilt?- Entdeckung der Geschichte unserer Doppelstadt Frankfurt (Oder)/ Słubice'. 15230 Frankfurt (Oder)
Projektort: 15230 Frankfurt (Oder)
Landkreis: Frankfurt/Oder
Träger: pewobe gGmbH
Die Begleiterin und die 12 Mitglieder der Jugendgruppe, im Alter von 13-21 Jahren, sind Teil des deutsch-polnischen Kompetenzteams in Frankfurt (Oder). Die Gruppe setzt sich aus Jugendlichen aus Deutschland, Polen sowie Jugendlichen ukrainischer und syrischer Herkunft zusammen. Das Projektthema bezieht sich direkt auf die Region und ihre Vorzüge. Słubice und Frankfurt (Oder) sind bekannt für ihre besondere Lage, Zusammenarbeit und kulturelle Vielfalt. Die Erforschung der Geschichte der Region wird von ihnen als wichtig erachtet, da sie bisher nicht konkret beschrieben wurde. Ziel ist es, gemeinsam zu überlegen, wie diese Geschichte an zukünftige Generationen weitergegeben werden kann.
Im Rahmen des Projekts wird ein Workshop für die lokalen Bewohner*innen organisiert, um die Entwicklung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit zu diskutieren und Ideen zu sammeln. Die Jugendlichen planen auch die Erstellung eines Videos, das das Leben in Frankfurt (Oder) und Słubice in Vergangenheit und Gegenwart zeigt. Dieses Video wird den Anwohner*innen während des Workshops präsentiert.
Um ein besseres Verständnis für die Geschichte der letzten 100 Jahre zu erhalten, werden sie das Stadtarchiv in Frankfurt (Oder) sowie die Stadtbibliothek in Słubice besuchen. Während ihrer Entdeckungsreise durch die Geschichte werden sie Senior*innen von der Organisation „My Life“ in Frankfurt (Oder) und Senioren aus Cybinka treffen. Ein weiterer Höhepunkt ist der Besuch einer anderen Doppelstadt, Zgorzelec-Görlitz. Dort werden sie recherchieren, eine Stadtführung machen und sich mit Jugendlichen sowie Zeitzeug*innen austauschen.
﹀'Die Glocken sind verklungen...', 01979 Lauchhammer, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Projektort: 01979 Lauchhammer
Landkreis: OSL
Träger: Evangelische Kirchengemeindeverband Lauchhammer
Die vier Jugendlichen und die Projektleiterin, eine Sozialarbeiterin an der Oberschule „Am Wehlenteich“ in Lauchhammer, haben sich zusammengefunden, um die Geschichte des Glockengusses in Lauchhammer zu erforschen. Die Kunstgießerei Lauchhammer war weltweit bekannt für ihren Bronzeguss, insbesondere für die Herstellung von Glocken. Kirchengemeinden kamen aus der ganzen Welt, um beim Guss und der Weihe ihrer Glocken dabei zu sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg verstummten plötzlich der Glockenguss in Lauchhammer. Was war passiert? 1989 erlebte der Glockenguss durch die Wende eine kurzzeitige Wiederbelebung. Doch warum werden heute keine Glocken mehr im Kunstguss Lauchhammer hergestellt? Welche Geschichten können uns Zeitzeug*innen über diese Ära erzählen? Welche persönlichen Schicksale sind mit dem Ende des Glockengusses verbunden? Gibt es politische Hintergründe?
Die Ergebnisse des Projekts werden dem zukünftigen Museum „Kohle-Energie-Kunstguss“ zur Verfügung gestellt. Innerhalb des Schulalltags und im Rahmen der Festveranstaltung „70 Jahre Schule“ im September 2024 wird das Thema eine Bühne finden. Die Gruppe plant, im Kunstgussmuseum fündig zu werden und hat bereits zwei Zeitzeug*innen gefunden, die bereit sind, ihre Geschichten zu teilen. Der Kultur- und Heimatverein in Lauchhammer sowie die Stiftung „Freunde des Kunstgusses“ werden ebenfalls als potenzielle Quellen genutzt.
Die gesammelten Informationen werden digitalisiert und im Rahmen des „Tags der offenen Schultür anlässlich 70 Jahre Schule“ im September 2024 präsentiert. An diesem Tag wird es eine Ausstellung von ausgewählten Zeitensprünge-Projekten geben, die bereits in den Jahren 2007-2024 zu anderen regionalgeschichtlichen Themen stattgefunden haben. Ehemalige und aktuelle Zeitenspringer*innen werden durch die Regionalgeschichte führen und die Besucher durch die Ausstellung moderieren.
﹀'Zwischen Noah und Franziskus - Gedanken über Wahrheit und Lüge, über Verschwörung und Zukunftsgestaltung', 14476 Brandenburg/Havel
Projektort: 14776 Brandenburg/Havel
Landkreis: Brandenburg/Havel
Träger: Pirckheimer Gesellschaft
Die Jugendgruppe, bestehend aus Jugendlichen aus den Dörfern Klein Kreutz, Marzahne, Schenkenberg und Brandenburg/H., die in der kreisfreien Stadt zur Schule gehen, hat sich zusammengefunden, um ihre Gedanken und Lösungen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen schriftstellerisch festzuhalten. Basierend auf ihren Leseerfahrungen, Kunstgesprächen im Museum Barberini und philosophischen Diskussionen möchten sie ihre Reflexionen in einem Buch der Öffentlichkeit präsentieren. Im Buch werden sich Texte und Illustrationen der jungen Menschen finden und es wird öffentliche Lesungen sowie Presseinformationen geben. Dieses Buch wird sowohl in der Stadt, bei der Jugendgeschichtsmesse im November 2024 als auch bei der Buchmesse in Leipzig vorgestellt und in der Presse veröffentlicht.
Ein besonderer Aspekt des Projekts ist die Beteiligung einer Gruppe polnischer Kinder aus Sopot, die sich ebenfalls dem Thema der Beschaffenheit und Bedrohung unserer Demokratie auseinandersetzen. Durch den Kontakt ihnen ergeben sich weitere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und kulturellen Austausch. Das Projekt zielt darauf ab, wichtige gesellschaftliche Themen kreativ zu beleuchten und einen interkulturellen Dialog zu fördern. Themen wie Verschwörungsfantasien, Kriegsbedrohungen in der Ukraine, Klimawandel mit Trockenheit, Fluten, Hunger, Flucht und Migration werden diskutiert. Der Untertitel des Buches lautet „ein Buch über Wahrheit und Lüge, über Verschwörung und Zukunftsgestaltung“. Die Jugendlichen lesen Texte über Noah und die Arche ebenso wie zeitgenössische Literatur wie Maja Lunde’s „Geschichte der Bienen“ und Dorothe Sölle’s „Noah in Manhattan“. Sie analysieren aktuelle Zeitungsberichte aus der Region und der Welt und treffen besipielsweise Expert*innen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
﹀'Stolpersteine in Ketzin/Havel', 14669 Ketzin, Landkreis Havelland
Projektort: 14669 Ketzin/Havel
Landkreis: HVL
Träger: Mikado e.V.
Im Rahmen verschiedener Jugendprojekte des Mikado e.V. in Ketzin/Havel und durch die Zusammenarbeit mit der örtlichen Oberschule entstand der Kontakt zu einer Gruppe von 10 Jugendlichen, die sich in diesem Projekt auf Spurensuche begeben werden. Bisher gibt es keine Stolpersteine in Ketzin/Havel, was jedoch nicht bedeutet, dass es keine Schicksale von Menschen gibt, die unmittelbar mit der NS-Zeit und dem Holocaust verbunden sind. Das Ziel des Projekts ist es, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, deren Geschichte zu erforschen und sichtbar zu machen.
Während einer Jugendaktion sind den Jugendlichen Stolpersteine in Nauen aufgefallen, was sie dazu veranlasste, sich zu fragen, ob es auch Menschen in Ketzin/Havel gab, die während des Holocaust ermordet wurden oder aus ihrer Heimat flüchten mussten. Durch einen ersten Kontakt mit der Stolperstein-Gruppe Falkensee wurde deutlich, dass es in auch in Ketzin Menschen gab, die aufgrund von Diskriminierung und Bedrohung während des Holocaust ihre Heimat verlassen mussten. Einige Schicksale sind bis heute unbekannt. Die Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren zeigen großes Interesse an der lokalen Geschichte und sind zum ersten Mal direkt mit den Verbrechen während der NS-Zeit konfrontiert. Sie stellen sich Fragen nach den Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, und wie sich die Bevölkerung damals dazu verhalten hat. Dabei ziehen sie auch Parallelen zur Gegenwart und aktuellen Ereignissen.
Das Projekt wird eng mit der Stolpersteingruppe Falkensee und dem Heimatverein Ketzin/Havel kooperieren. Die Jugendlichen werden sich mit einer oder mehreren Lebensgeschichten auseinandersetzen und die Verlegung eines oder mehrerer Stolpersteine in Ketzin/Havel begleiten. Die Ergebnisse werden sowohl im Rathaus als auch während der Jahresfeier der Oberschule im Herbst 2024 einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Die genaue Form der Präsentation wird gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet und umgesetzt.
Wir möchten, dass sowohl die Projekte untereinander, als auch wir mit euch, in einem steten Austausch miteinander stehen. Dazu bieten wir folgende Online-Treffen (jeweils von 15:00 – 18:00 Uhr) an, die zumeist auch einen Fortbildungsanteil haben:
 Mit dem Jugendprogramm Zeitensprünge suchen wir auch 2024 wieder spannende Geschichten aus eurer Heimatregion. Der Forschungszeitraum bezieht sich auf die letzten 100 Jahre.
Mit dem Jugendprogramm Zeitensprünge suchen wir auch 2024 wieder spannende Geschichten aus eurer Heimatregion. Der Forschungszeitraum bezieht sich auf die letzten 100 Jahre. „Zeitensprünge“ ermöglicht euch, Geschichte bei Euch vor Ort zu entdecken. Ihr könnt mit Freund*innen oder anderen interessierten Jugendlichen zusammen ein Thema wählen, welches ihr spannend findet! Stellt Fragen, die noch niemand gestellt hat! Tragt Bruchstücke der Geschichte zusammen und sichert Fundstücke! Schreibt und gestaltet interessante Dokumentationen, die den Menschen in eurem Ort fast Vergessenes in Erinnerung bringen! Ihr trefft andere Zeitenspringer*innen, um eure Erfahrungen auszutauschen und zeigt am Ende des Projekts eure entstandenen Magazine, Ausstellungen, Hörspiele, Filme, ….
„Zeitensprünge“ ermöglicht euch, Geschichte bei Euch vor Ort zu entdecken. Ihr könnt mit Freund*innen oder anderen interessierten Jugendlichen zusammen ein Thema wählen, welches ihr spannend findet! Stellt Fragen, die noch niemand gestellt hat! Tragt Bruchstücke der Geschichte zusammen und sichert Fundstücke! Schreibt und gestaltet interessante Dokumentationen, die den Menschen in eurem Ort fast Vergessenes in Erinnerung bringen! Ihr trefft andere Zeitenspringer*innen, um eure Erfahrungen auszutauschen und zeigt am Ende des Projekts eure entstandenen Magazine, Ausstellungen, Hörspiele, Filme, …. Für die Durchführung und Dokumentation erhält jede Gruppe eine Zuwendung in Höhe von bis zu 1.400 Euro. Kosten, die für das Projekte anfallen, könnten sein: Ausgaben für Archivbesuche, Büromaterialien, Fotoentwicklung, Kauf von Bildrechten, Miete von technischen Geräten, Honorare für die Projektbegleitung, Übernachtungs- und Fahrtkosten, Kosten für Farb- und Großkopien, Druck, Ausstellungsbedarf, …
Für die Durchführung und Dokumentation erhält jede Gruppe eine Zuwendung in Höhe von bis zu 1.400 Euro. Kosten, die für das Projekte anfallen, könnten sein: Ausgaben für Archivbesuche, Büromaterialien, Fotoentwicklung, Kauf von Bildrechten, Miete von technischen Geräten, Honorare für die Projektbegleitung, Übernachtungs- und Fahrtkosten, Kosten für Farb- und Großkopien, Druck, Ausstellungsbedarf, …